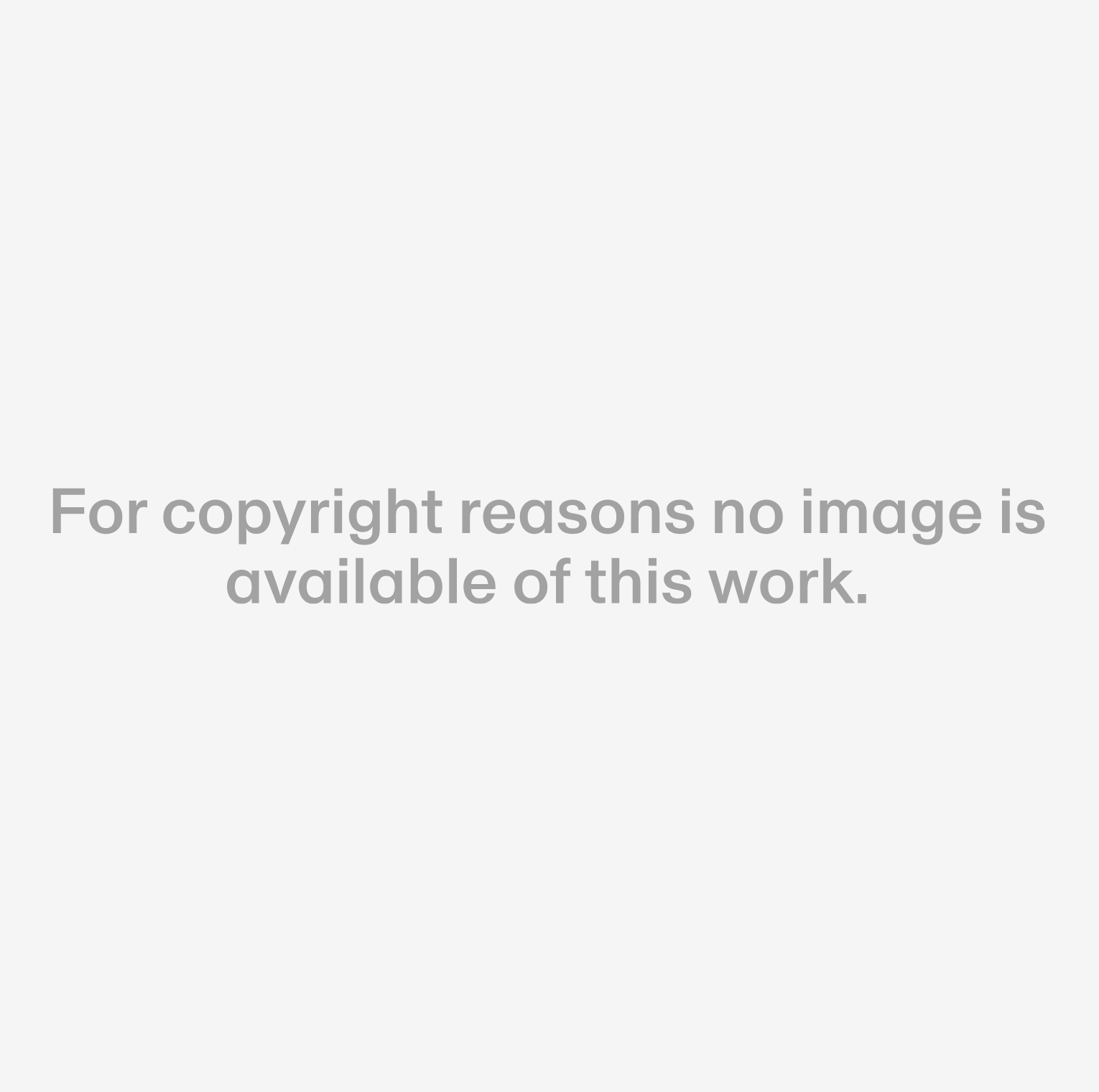Imre Kocsis
Imre Kocsis (1937, Karcag, HU – 1991, Kaltenherberge, DE) fand seinen Weg in die Kunst über Umwege: Mit sechzehn Jahren schloss er eine Heizungsmonteurlehre ab und schlug sich danach als Hilfsarbeiter und Einkäufer durch. Mehr zufällig begann er, abendlichen Zeichenunterricht und parallel dazu das Abendgymnasium zu besuchen. Seine Beteiligung am Ungarischen Volksaufstand von 1956 zwang ihn dann zur Flucht aus seiner Heimat. In Hamburg verdingte er sich zunächst auf einer Werft, während er abends die zeichnerische Ausbildung fortsetzte. 1958 begann er sein Studium an der Hochschule für bildende Künste Hamburg, wo er von 1960 bis 1962 auch als Assistent für grafische Techniken wirkte. Nach einem Frankreichaufenthalt Anfang der 1960er-Jahre verlegte er sein Atelier zunächst nach München, 1971 nach Düsseldorf. Die inspirierende Wirkung fremder Städte blieb wichtig für Kocsis: Zweimal, 1978 und 1982, bezog er ein Gastatelier im Amsterdamer Stedelijk Museum, und 1980 ermöglichte ihm ein Arbeitsstipendium der Stadt Düsseldorf und der Poensgen-Stiftung einen halbjährigen Aufenthalt am P.S.1 in New York. Ab 1985 war er Gastdozent für Bildhauerei an der Schule für Bildende Kunst in Reykjavik.
Sein Werk hatte sich zunächst im Bereich der Grafik, der Collage, der Zeichnung und Malerei entwickelt und bewegte sich bis 1967 suchend zwischen gegenständlichen, abstrakten und informellen Stilrichtungen. Ab 1968 entfaltete Kocsis sein streng konstruktives Œuvre, das ihm in den Kreisen der konstruktiv-konkreten Bewegung viel Anerkennung einbrachte. Mit nun konsequent schwarz-weisser Farbpalette und einfachen, geometrischen Grundformen deklinierte Kocsis die Möglichkeiten der Wiederholung und Variation einzelner Bildelemente in serieller Reihung, zentraler Anordnung oder Achsenspiegelung durch. Er spielte mit optischen Irritationen, Positiv- und Negativformen sowie mit räumlichen Effekten. Im Sammlungsstück des Museum Haus Konstruktiv sind Würfelformen angedeutet, die sich scheinbar in schwarze, zylindrische Elemente «ergiessen», während kontrastierende, weisse Kreise zusätzliche Dynamik erzeugen.
Gegen Ende der 1970er-Jahre vollzog Kocsis mit seinen Arbeiten den Schritt in den realen Raum: Meist balkenähnliche Elemente aus schwarz bemaltem Pressspan wurden scheinbar zufällig auf dem Boden positioniert, an Wände gelehnt oder montiert und definierten die Architektur, aber auch den «Zwischenraum» von Werk und Betrachter neu. Mit diesen installativen Anordnungen wie auch mit seinen Bildern forderte Kocsis unermüdlich die Sehgewohnheiten der Betrachtenden heraus.
Deborah Keller
Sein Werk hatte sich zunächst im Bereich der Grafik, der Collage, der Zeichnung und Malerei entwickelt und bewegte sich bis 1967 suchend zwischen gegenständlichen, abstrakten und informellen Stilrichtungen. Ab 1968 entfaltete Kocsis sein streng konstruktives Œuvre, das ihm in den Kreisen der konstruktiv-konkreten Bewegung viel Anerkennung einbrachte. Mit nun konsequent schwarz-weisser Farbpalette und einfachen, geometrischen Grundformen deklinierte Kocsis die Möglichkeiten der Wiederholung und Variation einzelner Bildelemente in serieller Reihung, zentraler Anordnung oder Achsenspiegelung durch. Er spielte mit optischen Irritationen, Positiv- und Negativformen sowie mit räumlichen Effekten. Im Sammlungsstück des Museum Haus Konstruktiv sind Würfelformen angedeutet, die sich scheinbar in schwarze, zylindrische Elemente «ergiessen», während kontrastierende, weisse Kreise zusätzliche Dynamik erzeugen.
Gegen Ende der 1970er-Jahre vollzog Kocsis mit seinen Arbeiten den Schritt in den realen Raum: Meist balkenähnliche Elemente aus schwarz bemaltem Pressspan wurden scheinbar zufällig auf dem Boden positioniert, an Wände gelehnt oder montiert und definierten die Architektur, aber auch den «Zwischenraum» von Werk und Betrachter neu. Mit diesen installativen Anordnungen wie auch mit seinen Bildern forderte Kocsis unermüdlich die Sehgewohnheiten der Betrachtenden heraus.
Deborah Keller
Werke von Imre Kocsis