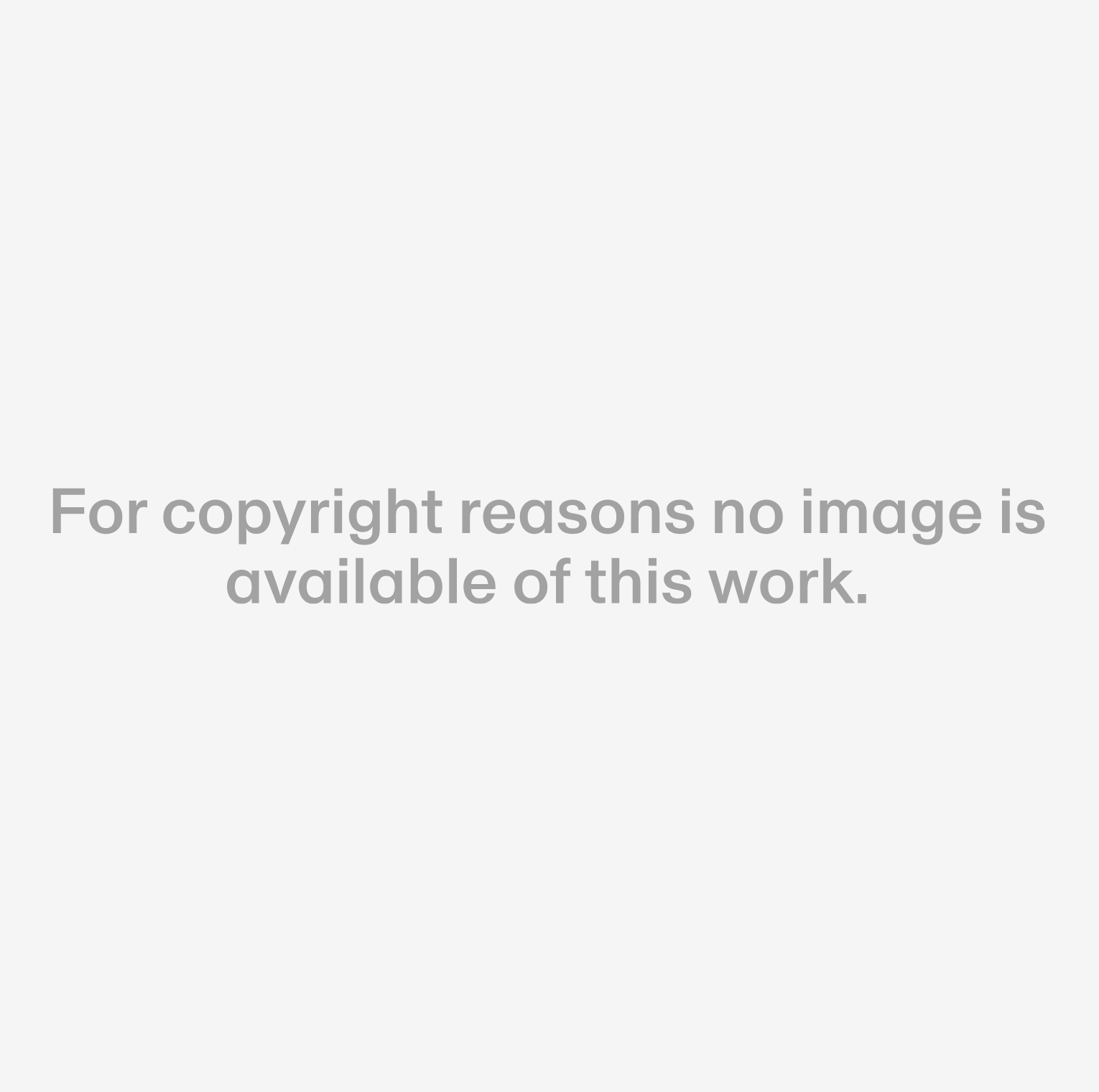Max Bill
Max Bill (1908, Winterthur, CH – 1994, Berlin, DE) hat die Malerei als Kernstück seiner breit gefächerten kreativen Arbeit verstanden: als ein freies Experimentierfeld ästhetischer Ideen. Diese beruhten auf Mass und Ordnung, gebunden in ein begründbares, rational strukturiertes Konzept. Er verstand sein Schaffen als einen durch die jeweilige Aufgabe bestimmten Auswahlprozess mit dem Ziel, die bestmögliche Lösung herauszuarbeiten. Er hat sein Vorgehen auch als «Umweltgestaltung nach der morphologischen Methode» bezeichnet. Letzten Endes aber übernehme die schöpferische Entscheidung die Regie und überspiele das begründbare Konzept.
Max Bill wirkte seit 1929 als Architekt in Zürich, geprägt von seinem Studium am Bauhaus in Dessau in dessen zweiter, funktional orientierten Phase. Mit seinem 1932 in Zürich-Höngg in neuartiger Elementbauweise errichteten Atelierhaus setzte er sein ästhetisches Ideal einer «schönheit als funktion und aus funktion» stilbildend um. Bill war ein Künstler im universalen Sinn der Moderne: Maler, Grafiker, Plastiker, Architekt, Produktgestalter, Pädagoge und nicht zuletzt Autor zahlreicher Texte zur Philosophie und Praxis der bildenden und angewandten Kunst. Er wirkte mit dem Anspruch, der modernen, technologisch gesteuerten Zivilisation eine zeitgemässe, harmonisierte Lebensgrundlage zu schaffen. Die Kunst: der ästhetische Überbau.
Max Bill war ein begnadeter Propagandist seiner Ideale, jedoch kein Doktrinär. Seine Grundsätze der konkreten Kunst, mit der man ihn identifizierte, entwickelte er nach dem Vorbild Theo van Doesburgs. 1936 verfasste er dazu den ersten Grundsatztext. Am Bauhaus hatte Max Bill die Malklassen von Paul Klee und Kandinsky belegt; in den frühen 1930er-Jahren besuchte er den für ihn inspirativ beispielhaften Piet Mondrian in Paris. Einflüsse verwandelte er in ein eigenes Erfindungsfeld; zur Ikone elementarer, kombinatorisch sich entwickelnder Bildideen wurde seine zwischen 1936 und 1938 entstandene Grafikfolge «15 variations sur un même thème». Er entwickelte Themenfolgen in der Malerei, exemplarisch etwa die in Quadratstrukturen angelegten Farbideen, in seiner Plastik die unendlich in sich zurückkehrende Schleifenform. Als Kernstück seiner Zweck, Situation und formale Erscheinung integrierenden Vision verstand er den Bau und das pädagogische Konzept der Hochschule für Gestaltung in Ulm in den 1950er-Jahren. Max Bill blieb in Zürich sesshaft, er bereiste die Welt, schuf sich ein globales Netzwerk zu verwandt kreativen Persönlichkeiten und trug seine Botschaft bis nach Südamerika. Er erlebte noch mit kritischer Distanz die sich durch die aufkommende Informationsgesellschaft verändernde Physiognomie der Moderne und die pluralistische Demontage von deren universalem Erfindergeist. Max Bill bleibt ein Repräsentant der Moderne insbesondere durch die authentische Strahlkraft seiner Bilderwelt und die Geometrie der über sich selbst hinausführenden ästhetischen Eleganz seiner Skulpturen. Beispiele davon und ein Exemplar der «15 variations» befinden sich in der Sammlung des Museum Haus Konstruktiv.
Margit Weinberg Staber
Max Bill wirkte seit 1929 als Architekt in Zürich, geprägt von seinem Studium am Bauhaus in Dessau in dessen zweiter, funktional orientierten Phase. Mit seinem 1932 in Zürich-Höngg in neuartiger Elementbauweise errichteten Atelierhaus setzte er sein ästhetisches Ideal einer «schönheit als funktion und aus funktion» stilbildend um. Bill war ein Künstler im universalen Sinn der Moderne: Maler, Grafiker, Plastiker, Architekt, Produktgestalter, Pädagoge und nicht zuletzt Autor zahlreicher Texte zur Philosophie und Praxis der bildenden und angewandten Kunst. Er wirkte mit dem Anspruch, der modernen, technologisch gesteuerten Zivilisation eine zeitgemässe, harmonisierte Lebensgrundlage zu schaffen. Die Kunst: der ästhetische Überbau.
Max Bill war ein begnadeter Propagandist seiner Ideale, jedoch kein Doktrinär. Seine Grundsätze der konkreten Kunst, mit der man ihn identifizierte, entwickelte er nach dem Vorbild Theo van Doesburgs. 1936 verfasste er dazu den ersten Grundsatztext. Am Bauhaus hatte Max Bill die Malklassen von Paul Klee und Kandinsky belegt; in den frühen 1930er-Jahren besuchte er den für ihn inspirativ beispielhaften Piet Mondrian in Paris. Einflüsse verwandelte er in ein eigenes Erfindungsfeld; zur Ikone elementarer, kombinatorisch sich entwickelnder Bildideen wurde seine zwischen 1936 und 1938 entstandene Grafikfolge «15 variations sur un même thème». Er entwickelte Themenfolgen in der Malerei, exemplarisch etwa die in Quadratstrukturen angelegten Farbideen, in seiner Plastik die unendlich in sich zurückkehrende Schleifenform. Als Kernstück seiner Zweck, Situation und formale Erscheinung integrierenden Vision verstand er den Bau und das pädagogische Konzept der Hochschule für Gestaltung in Ulm in den 1950er-Jahren. Max Bill blieb in Zürich sesshaft, er bereiste die Welt, schuf sich ein globales Netzwerk zu verwandt kreativen Persönlichkeiten und trug seine Botschaft bis nach Südamerika. Er erlebte noch mit kritischer Distanz die sich durch die aufkommende Informationsgesellschaft verändernde Physiognomie der Moderne und die pluralistische Demontage von deren universalem Erfindergeist. Max Bill bleibt ein Repräsentant der Moderne insbesondere durch die authentische Strahlkraft seiner Bilderwelt und die Geometrie der über sich selbst hinausführenden ästhetischen Eleganz seiner Skulpturen. Beispiele davon und ein Exemplar der «15 variations» befinden sich in der Sammlung des Museum Haus Konstruktiv.
Margit Weinberg Staber
Werke von Max Bill