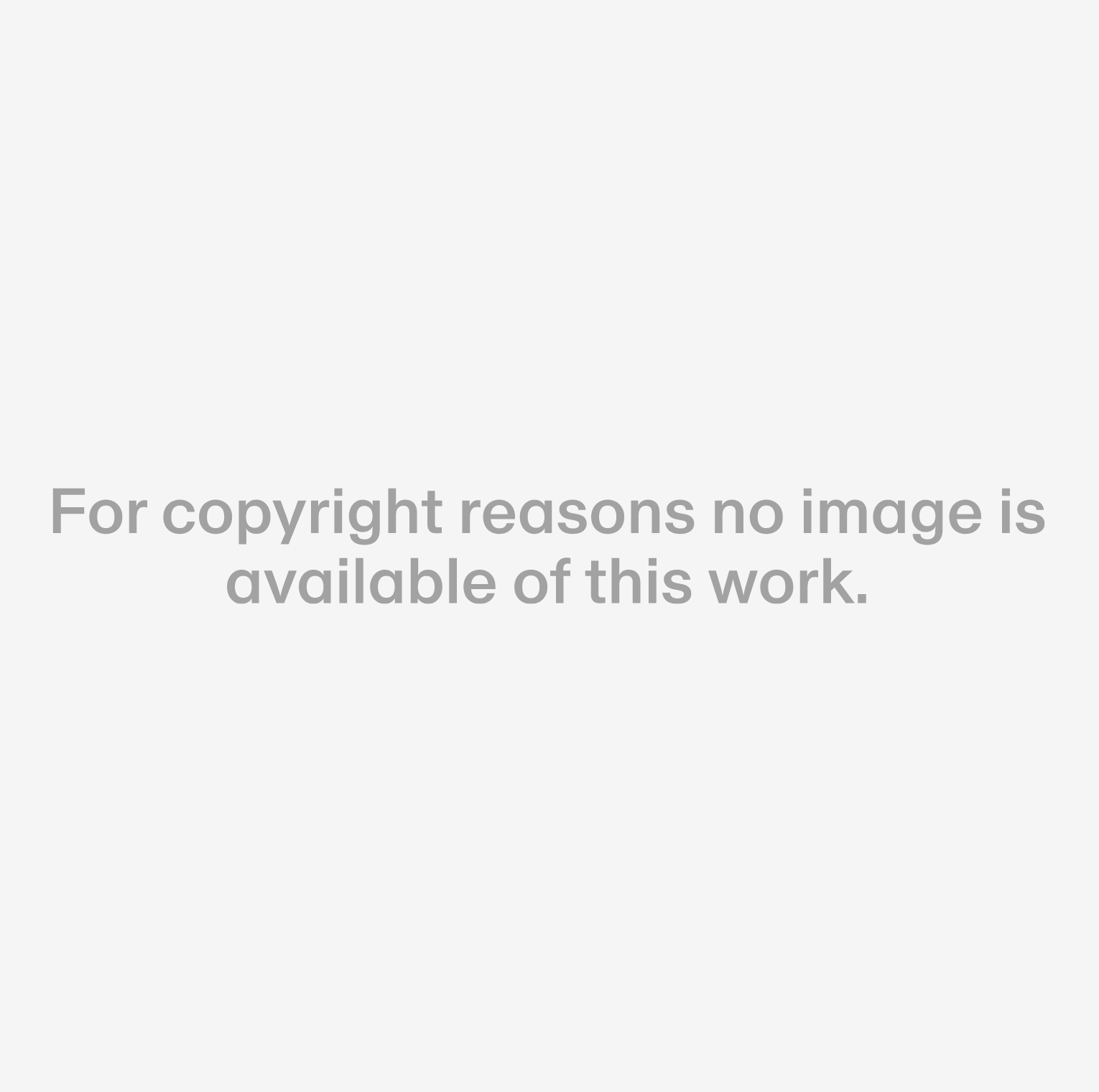Richard Paul Lohse
Der Wunsch von Richard Paul Lohse (1902, Zürich, CH – 1988, ebd.), sich künstlerisch auszubilden, scheiterte am frühen Tod seines Vaters. Er trat 16-jährig als Lehrling in das Zürcher Werbeatelier Max Dalang ein, machte sich 1930 als Grafiker selbstständig, redigierte und gestaltete von 1947 bis 1956 die Zeitschrift «Bauen + Wohnen» und war 1958–1985 Mitherausgeber der Zeitschrift «Neue Grafik». Lohse hat die Geschichte der modernen Schweizer Grafik mit geschrieben, ist in breiten Kreisen jedoch hauptsächlich als ein Hauptvertreter der konstruktiv-konkreten Kunst bekannt. Beide Schaffensbereiche zeichnen sich durch einen hohen Anspruch an die Ästhetik in Verbindung mit einer zutiefst ethischen Grundhaltung aus, Ausdruck von Lohses Überzeugung: «Es gibt keine Definition der Ästhetik ohne Definition ihrer gesellschaftlichen Basis.»
Nach figurativen und abstrakten Anfängen wandte sich Lohse, inspiriert vom russischen Konstruktivismus und von der De-Stijl-Bewegung, Mitte der 1930er-Jahre der geometrischen Bildsprache zu. Er befasste sich mit systematischen Diagonal- und Orthogonalstrukturen, u. a. mit dem Fugenthema, auf dessen Bildsprache die 1952/1958 ausgeführte Gouache «Variation eines Fugenthemas» zurückgreift. Um 1940 begann Lohse, seine Grundsätze unter dem Gesichtspunkt der «Kombinatorik als Methode» in den theoretischen Schriften «Entwicklungslinien» darzulegen. Vorerst hielt er seine von der Gruppentheorie der Mathematik abgeleiteten Systemordnungen in Farbstiftstudien fest, um sie teilweise erst Jahre später in Malerei zu transferieren, worüber der Datierungsmodus (Konzeption/Ausführung) Aufschluss gibt. Ab den 1940er-Jahren verlegte sich Lohse mit der sukzessiven Entwicklung seiner «Modularen und Seriellen Ordnungen» auf bildfüllende, nichthierarchische Systeme, die auf einer Vereinheitlichung von Bildmittel, Bildstruktur und Bildformat beruhen. Die «Modularen Ordnungen» umfassen meist komplementäre Farbgruppen, die wie in den aus einer Quadratserie stammenden Serigrafien «Drei komplementäre Kontraste» sowie «Durchdringung von drei horizontalen Bändern» aneinandergereiht sein können bzw. wie in «Vier verbundene Gruppen» oder «Zwei Bewegungen um eine Achse» durch Verschränken, Kreuzen oder durch Drehen um eine Achse miteinander verspannt sind. Bei den «Seriellen Ordnungen» handelt es sich um bis zu dreissigstufige chromatische Reihen in zyklisch oder doppelzyklisch angelegten Farbketten von meist hochgradiger Bewegungsstruktur.
Die geradezu grenzenlose Farb-/Formkombinatorik, die aus Richard Paul Lohses Methodik resultierte, oft als «ars combinatoria» tituliert, macht sein Werk, das neben den Hauptzweigen Malerei, Zeichnung und Druckgrafik auch Kunst am Bau umfasst, einzigartig. Es hat zur Neupositionierung der konstruktiv-konkreten Kunst beigetragen und massgeblich auf das Schaffen nachfolgender Generationen eingewirkt. International hochgeschätzt, nahm Lohse an zahlreichen Ausstellungen teil. Mit Max Bill, Camille Graeser und Verena Loewensberg dem inneren Kreis der sogenannten Zürcher Konkreten zugehörig, wurde er 1973 mit dem Kunstpreis der Stadt Zürich geehrt. 1987 folgte die Ernennung zum «Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres» in Frankreich. Sein Nachlass wurde 1987 in die Richard Paul Lohse-Stiftung in Zürich überführt.
Elisabeth Grossmann
Nach figurativen und abstrakten Anfängen wandte sich Lohse, inspiriert vom russischen Konstruktivismus und von der De-Stijl-Bewegung, Mitte der 1930er-Jahre der geometrischen Bildsprache zu. Er befasste sich mit systematischen Diagonal- und Orthogonalstrukturen, u. a. mit dem Fugenthema, auf dessen Bildsprache die 1952/1958 ausgeführte Gouache «Variation eines Fugenthemas» zurückgreift. Um 1940 begann Lohse, seine Grundsätze unter dem Gesichtspunkt der «Kombinatorik als Methode» in den theoretischen Schriften «Entwicklungslinien» darzulegen. Vorerst hielt er seine von der Gruppentheorie der Mathematik abgeleiteten Systemordnungen in Farbstiftstudien fest, um sie teilweise erst Jahre später in Malerei zu transferieren, worüber der Datierungsmodus (Konzeption/Ausführung) Aufschluss gibt. Ab den 1940er-Jahren verlegte sich Lohse mit der sukzessiven Entwicklung seiner «Modularen und Seriellen Ordnungen» auf bildfüllende, nichthierarchische Systeme, die auf einer Vereinheitlichung von Bildmittel, Bildstruktur und Bildformat beruhen. Die «Modularen Ordnungen» umfassen meist komplementäre Farbgruppen, die wie in den aus einer Quadratserie stammenden Serigrafien «Drei komplementäre Kontraste» sowie «Durchdringung von drei horizontalen Bändern» aneinandergereiht sein können bzw. wie in «Vier verbundene Gruppen» oder «Zwei Bewegungen um eine Achse» durch Verschränken, Kreuzen oder durch Drehen um eine Achse miteinander verspannt sind. Bei den «Seriellen Ordnungen» handelt es sich um bis zu dreissigstufige chromatische Reihen in zyklisch oder doppelzyklisch angelegten Farbketten von meist hochgradiger Bewegungsstruktur.
Die geradezu grenzenlose Farb-/Formkombinatorik, die aus Richard Paul Lohses Methodik resultierte, oft als «ars combinatoria» tituliert, macht sein Werk, das neben den Hauptzweigen Malerei, Zeichnung und Druckgrafik auch Kunst am Bau umfasst, einzigartig. Es hat zur Neupositionierung der konstruktiv-konkreten Kunst beigetragen und massgeblich auf das Schaffen nachfolgender Generationen eingewirkt. International hochgeschätzt, nahm Lohse an zahlreichen Ausstellungen teil. Mit Max Bill, Camille Graeser und Verena Loewensberg dem inneren Kreis der sogenannten Zürcher Konkreten zugehörig, wurde er 1973 mit dem Kunstpreis der Stadt Zürich geehrt. 1987 folgte die Ernennung zum «Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres» in Frankreich. Sein Nachlass wurde 1987 in die Richard Paul Lohse-Stiftung in Zürich überführt.
Elisabeth Grossmann
Werke von Richard Paul Lohse